Kurosch Yazdi im Interview über das Phänomen Sucht, die tiefen Wurzeln der Volksdroge Alkohol, und warum es meist nicht bei einer Sucht bleibt.
Herr Yazdi, In Ihrem Buch „Junkies wie wir“ schreiben Sie, die Veranlagung zur Sucht schlummert in jedem von uns. Was entscheidet darüber, bei wem sie ausbricht und bei wem nicht?
Die Bereitschaft zur Sucht schlummert in jedem von uns, weil jeder ein Belohnungszentrum im Hirn hat. Wenn dieses überstimuliert wird, gewöhnt es sich an die Stimulation und fordert sie ein. Was eine Sucht ist, ist relativ klar durch die WHO definiert: Es gibt sechs Kriterien, und wenn drei davon über mehrere Monate gleichzeitig vorhanden sind, spricht man von Sucht. Die WHO hat diese Suchtkriterien zunächst nur für Substanzsüchte formuliert, Tatsache ist aber, dass diese Kriterien auch auf Verhaltenssüchte wie Kaufsucht oder Technologiesüchte angewandt werden können. (siehe Kriterien)
Was bringt diese schlummernde Disposition zum Ausbrechen? Warum wird einer, der jeden Abend sein Glas Rotwein trinkt, zum Alkoholiker – und ein anderer, der dasselbe tut, nicht?
Da gibt es verschiedene Faktoren. Gewöhnung gibt es zum Beispiel auch bei kleinen Dosen: Wenn jemand jeden Abend sein Achterl Rotwein trinkt, wird er vielleicht in fünf Jahren täglich zwei Achterl trinken und ist vielleicht noch weit weg von einer Sucht. Aber die Gewöhnung kann im Lauf der Zeit entarten: Plötzlich trinkt er zwei Achterl, weil es ihm so schmeckt. Er macht einen Weinkurs, weil das so modern ist. Wenn man sich gut auskennt, trinkt man gern auch mehr, weil man verschiedenes ausprobieren will. Dann trinkt er auch zu Mittag im Restaurant. Es wird immer mehr, ohne dramatischen Hintergrund.
Dieses Hineingleiten kann eine Möglichkeit sein, das andere sind etwa traumatische Dinge: Jemand stirbt, es kommt zu einer Scheidung, einem Jobverlust, man ist bekümmert und versucht seine Sorgen wegzutrinken. Eine weitere Möglichkeit ist, dass Gruppen mitreißen, etwa die Peer Group bei Jugendlichen. Das nächste wäre Suchtverschiebung: Ich habe schon eine Sucht, will damit aufhören und konsumiere dafür umso mehr vom anderen, auch ganz häufig der Fall. Letztlich ist auch die Verfügbarkeit entscheidend: wir werden nach den Dingen süchtig, die verfügbar sind. In dem Land, wo ich herkomme, im Iran, ist Alkohol nicht verfügbar – dadurch finden sie dort fast keine Alkoholsüchtigen. Aber Sie finden sehr viele Heroinsüchtige, es ist im Iran sehr billig verfügbar.
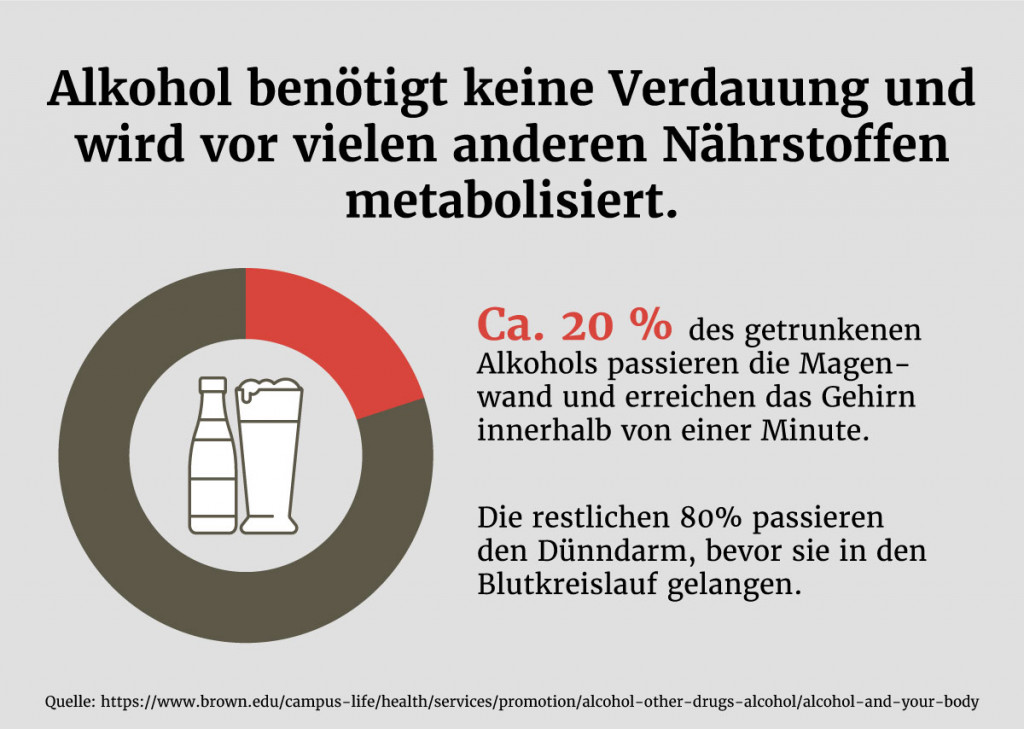
Was entscheidet darüber, welche Sucht jemand bekommt? Warum wird der eine kaufsüchtig, ein anderer spielsüchtig? Ist es einfach Zufall, womit man in Berührung kommt?
Ein bisschen ist es Zufall. Wenn meine Peer Group raucht, rauche ich, wenn meine Peer Group säuft, saufe ich. Ich mache den Blödsinn, den meine Peer Group macht. Auch später: Wenn meine Freundinnen einkaufen, gehe ich auch einkaufen. Letztlich schauen wir uns unser Verhalten und unsere Werte am Rudel ab. Es gibt aber auch Unterschiede zwischen den Süchten: Manche sind belohnungsorientiert, manche entspannungsorientiert. Und es geht um die Verfügbarkeit: Wenn jemand arm ist, wird er wahrscheinlich nicht kaufsüchtig werden. Er kommt gar nicht zum regelmäßigen Kaufen, das kann er sich nicht leisten.
Es bleibt ja oft nicht bei einer Sucht…
Ja, Sie finden fast keinen Menschen, der ein Alkoholproblem hat und nicht raucht. Sie finden auch keinen Heroinsüchtigen, keinen Spielsüchtigen, der nicht raucht. Rauchen ist die Einstiegsdroge für fast jede Sucht überhaupt. Man fängt mit einer Sucht an, und sobald man eine Sucht hat, ist die Bereitschaft, an einer zweiten Sucht zu erkranken, viel höher, weil das Gehirn schon getriggert ist darauf.
Gibt es eine klassische „Alkoholikerkarriere“?
Nein, definitiv nicht. Wir haben den frustrierten Langzeitarbeitslosen, der den ganzen Tag zuhause ist und sich niedersäuft, damit er vom Tag nichts mitbekommt. Wir haben die engagierte Lehrerin, die aber im Burnout ist und am Abend zum Einschlafen Alkohol braucht. Wir haben Ärzte, die schwer alkoholabhängig sind. Und es gibt auch unter den Alkoholkranken so viele Unterschiede: Es gibt den Quartalssäufer, der tagelang nichts trinkt – aber wenn er säuft, dann so lange, bis er unter dem Tisch liegt. Dann gibt es den Spiegeltrinker, der über den ganzen Tag verteilt kleine Mengen trinkt, aber nie besoffen ist. Es gibt so viele Arten der Erkrankung, daß man von einem prototypischen Verlauf nicht reden kann.

Auch der Leidensdruck ist wohl sehr unterschiedlich? Manchmal werden ihn überhaupt nur die Angehörigen verspüren?
Das ist richtig: Der Spiegeltrinker will sich etwa einfach beruhigen, der ist nicht auf Belohnung aus. Der Quartalssäufer findet eine Party nur lustig, wenn er sich niedersäuft, er ist ein „sensation seeker“. Leidensdruck muss aus medizinischer Sicht da sein, damit man von einer Erkrankung sprechen kann, aber ob der beim Betroffenen oder beim Angehörigen ist, ist egal. Bei einem Alkoholiker, der seine Frau verprügelt, hat die Frau den Leidensdruck, er nicht.
Wenn nun ein Betroffener oder Angehöriger zu Ihnen kommt, wie gehen Sie vor?
Es gibt kein einheitliches Vorgehen. Die Patienten kommen zuerst einmal in die Alkoholambulanz zu uns. Wir haben hier im Jahr 10.000 Kontakte. Dann wird geschaut, wie stark das Problem ist. Wir untersuchen auch körperlich, wir schauen, ob der Patient überhaupt motiviert ist für eine Behandlung bzw. ob wir ihn motivieren können. Braucht er einen stationären Entzug, also eine Entgiftung, oder können wir das ambulant machen? Oder ist er vielleicht noch gar nicht so schwer krank und hat das nötige Problembewusstsein, dann reicht es möglicherweise auch, wenn er moderater trinkt. Dann gibt es natürlich auch Leute, die sich so betrinken, dass sie mit der Rettung hereingeführt werden, und von der Intensivstation zu uns kommen.
Bei einem massiven Alkoholproblem kommt jedenfalls zuerst der Entzug. Das ist rein körperlich – der Patient ist entgiftet, aber immer noch alkoholabhängig. Sobald er rausgeht, würde er weitertrinken. Dann kommt die psychische Entwöhnung: dabei geht es um die Frage, wie ich mein Leben ändern muss, damit ich wegbleiben kann vom Alkohol. Ich kann dann nicht jeden Tag ins Wirtshaus gehen und von mir selber erwarten, dass alle saufen und ich nüchtern bleibe. Wenn ich trocken bleiben will, muss ich die Orte wechseln, vielleicht sogar die Freunde. Ich muss andere Dinge finden, die mir Spaß machen. Ich muss Strategien entwickeln, wenn etwa auf einer Feier alle mit Sekt anstoßen.
Wie hoch ist die Rückfallquote?
Ohne abgeschlossene Behandlung ist die Rückfallquote extrem hoch. Nach abgeschlossener Behandlung gilt ungefähr die Drittelregel: Ein Drittel schafft es langfristig wegzubleiben, also über ein paar Jahre. Ein Drittel schafft es mittelfristig, und ein Drittel schafft es nur kurzfristig, zwischen einem Tag nach dem Aufenthalt und ein paar Monaten fangen sie immer wieder an zu trinken.
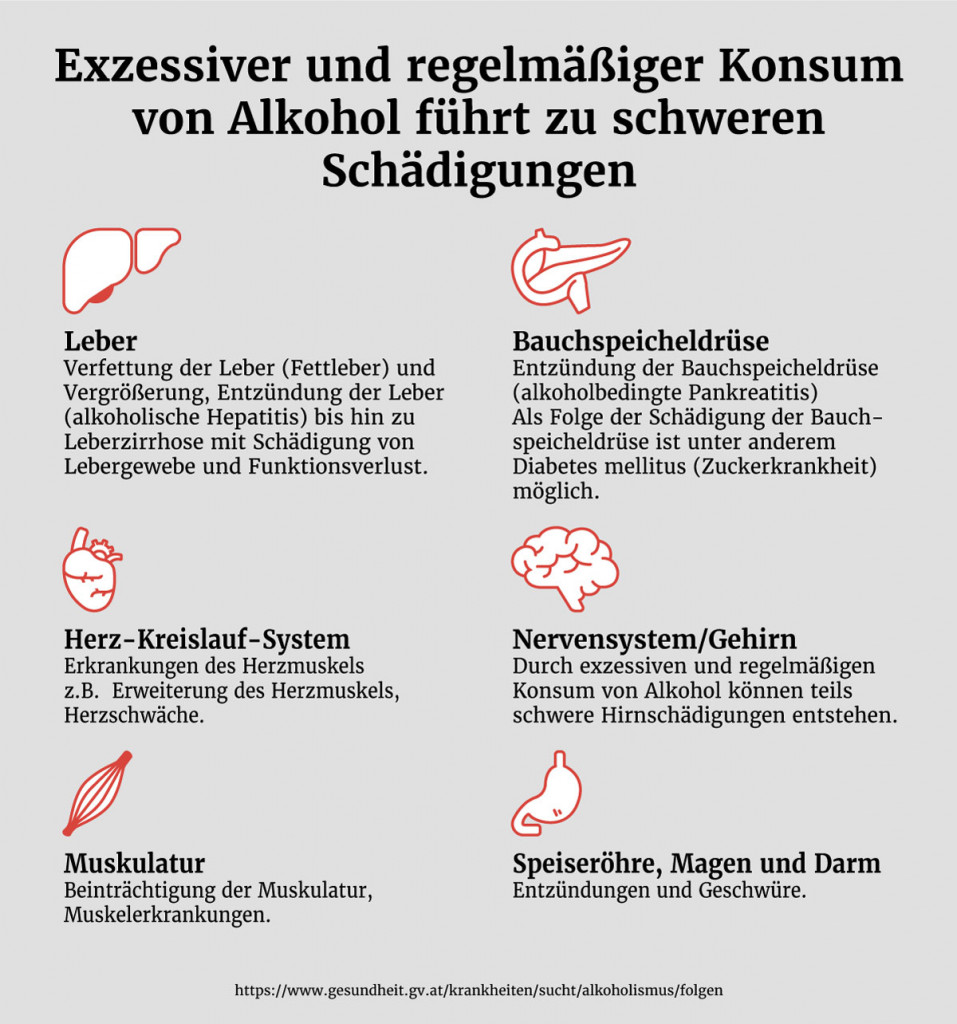
Es gibt ja beim Alkoholkonsum ein Nord-Süd-Gefälle, macht sich das auch im Alkoholismus bemerkbar? Welche Einflüsse entscheiden, ob in einem Land viel getrunken wird?
Natürlich gibt es kulturelle Einflüsse: in Russland etwa trinken die Leute einfach mehr. Die Verfügbarkeit ist auch sehr wichtig: in Österreich gibt es in den weinproduzierenden Gegenden mehr Alkoholiker als in den Bezirken, wo kein Wein angebaut wird. In den skandinavischen Ländern, wo der Alkohol eigentlich sehr teuer ist, würde man denken, die dürften gar nicht so viel trinken. Die Menschen verdienen dort aber auch viel mehr, und dann gibt es die Theorie mit dem fehlenden Sonnenlicht im Norden, dass die Leute dadurch depressiver sind. In Russland wird aber auch in den sonnigen Gegenden im Süden sehr viel getrunken, das sind kulturelle Einflüsse.
Es war etwa lange so, dass im Ostblock und in Russland Bier gar nicht als Alkohol angesehen wurde. Wir hatten früher viele Patienten aus Polen oder Rumänien, wenn man die gefragt hat, ob sie Alkohol trinken, verneinten sie. Die Leberwerte waren aber katastrophal, aber sie sagten, ich trinke nur Bier. Bier war also kein Alkohol. Und wenn eine Kultur schon so denkt, dann wird’s natürlich gefährlich. Kulturen sind aber auch im Wandel. Im Ostblock wird nicht mehr so unkritisch gesoffen wie früher.
Ist Alkohol überhaupt noch modern in einer Gesellschaft, in der alles schneller gehen soll? Es dauert ja relativ lange, um einen Kick davon zu bekommen.
Leider ja, er hat zu tiefe Wurzeln in der europäischen Kultur. Auch wenn andere Dinge kurzfristig modern werden – Alkohol bleibt trotzdem.
In Ihrem Buch schreiben Sie, Sucht sei „die Übertreibung von etwas ursprünglich Guten“. Wer definiert die Grenze, wo aus gut böse wird?
Medizinisch definiert die WHO diese Grenzen. Und sonst sagt die Gesellschaft, was für uns noch normal ist. Wenn jemand jeden Abend ein Achterl Wein trinkt, gilt das in Österreich als normal. Wenn Sie das gleiche im Iran sagen, gelten Sie als schwerer Alkoholiker, weil im Iran Alkohol so verboten ist.
Welche Wünsche haben Sie als Suchtexperte an Politik und Gesellschaft in Bezug auf den Alkohol?
Erstens ist es notwendig, dass wir die Werbung noch viel mehr einschränken. Das zweite: Alkohol hat immer noch in vielen Bereichen eine Normalität: Zum Beispiel am Land bei Festen der freiwilligen Feuerwehr, wo es natürlich Freibier gibt. Während Zigaretten vielerorts nicht mehr normal sind, ist Alkohol immer noch sehr normal. Man raucht mittlerweile im Restaurant kaum mehr, aber man kann sich nicht vorstellen, bei einem Fest nicht zu trinken. Es gibt aber auch positive Tendenzen, etwa, dass Supermärkte immer mehr aufpassen, ab wie viel Jahren sie Alkohol verkaufen.
Leben wir in einer Suchtgesellschaft?
Wenn man ein sensibilisiertes Auge hat, sieht man extrem viel an Sucht. Es sind vor allem die Verhaltenssüchte, die sehr im Steigen sind. Beim Alkohol sehe ich gar nicht so schwarz, es gibt sogar positive Tendenzen: In der Voest wurde noch bis Ende der 80er-Jahre extrem viel Alkohol getrunken. Es war völlig normal, dass die Leute mit Bierkisten in die Arbeit gegangen sind. Das ist heute nicht mehr möglich. Früher war die Konkurrenz nicht so stark, man konnte es sich leisten, dass ein Drittel der Arbeiter betrunken war, heute geht das nicht mehr. Das sind die positiven Aspekte einer Welt, in der die Konkurrenz immer härter wird. Es gibt aber immer noch zu viel Gewalt an Frauen und Kindern, man könnte viel Leid sparen, wenn man Alkohol eindämmen würde.

Was kann jeder Einzelne tun, um nicht in Suchtgefahr zu kommen?
Erstens: Manche Dinge sollte man gar nicht erst anfangen, wie Heroin, Kokain oder auch Nikotin. Zweitens: Wenn ich etwas konsumiere, sollte ich darauf achten, dass ich es maßvoll konsumiere, nicht täglich. Ich kann schon einmal über die Stränge schlagen, aber nicht jeden zweiten Tag. Drittens: Gefährlich wird ein Suchtmittel, wenn ich es nicht zum Genießen verwende, sondern als Werkzeug. Zum Beispiel den Alkohol zum Einschlafen oder zum Dazugehören. Wenn ich einmal im Jahr ins Casino gehe, ist das kein Problem – wenn ich glaube, dadurch Geld verdienen zu können, wird es gefährlich. Wichtig sind auch funktionierende Beziehungen: Wenn ich gute Beziehungen habe, brauche ich keinen Alkohol um meine Einsamkeit nicht zu spüren. Wenn ich gute Freunde im echten Leben habe, ist es egal, ob ich auf Facebook 30 oder 3000 Freunde habe. Wenn das Suchtmittel Ersatz für Beziehungen wird, wird es gefährlich.
Suchtkriterien:
- Zwang zu konsumieren
- Konsum wird erhöht für die gleiche Wirkung
- Entzugserscheinungen bei weniger/keinem Konsum
- Weitermachen trotz schädlicher Folgen
- Vernachlässigen anderer Interessen
- Kontrollverlust d.h. nicht mehr aufhören können, sobald man angefangen hat








